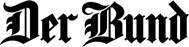Wer steht hinter «Grashaus Projects»?
«Grashaus Projects» ist ein Non-profit-Pilotversuch und Teil der 2018 in Berlin gegründeten Sanity Group. Eventuelle Überschüsse werden an lokale Suchtpräventionsstellen gespendet.
Der Studienpartner, das Schweizer Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung (ISGF), leitet die Studie wissenschaftlich, und die Psychiatrie Baselland steht als lokaler Partner bei ärztlicher Beratung und Hilfsangeboten für Studienteilnehmende zur Verfügung.
Gemeinsam will man erforschen, wie Cannabis im Freizeitgebrauch verantwortungsvoll zugänglich gemacht werden kann.